„Wir werden keine Chance haben, wenn wir uns nur auf die Technologie verlassen“

Der Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal forscht zum Thema Mensch-Tier-Beziehungen. Wie er die Corona-Krise erlebt hat und welche Chance er in der Digitalisierung sieht, erzählt er im Gespräch mit der Lichtung des BFW.
Lichtung: Sie haben als Wissenschaftler viele Bücher geschrieben, die sich nicht nur an ein Fachpublikum richten. Wie sehen Sie die Rolle des Wissensvermittlers?
Kurt Kotrschal: Ich habe immer wissenschaftlich publiziert und gleichzeitig auf einer anderen Schiene die Ergebnisse populär rausgebracht. Ich schreibe gerne. Die Leute, die die Wissenschaft finanzieren, das ist auch die Öffentlichkeit, haben ein Recht darauf zu erfahren, was läuft. Ich habe mitgeholfen, Institutionen aufzubauen, das ist die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle und das Wolfsforschungszentrum. Da ist Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Es ist auch im Interesse der Universität, die Öffentlichkeit am Wissen teilhaben zu lassen. Die Wissenschaft hat aber auch das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Der gelegentliche Elfenbeintum ist Grundvoraussetzung dafür, dass Wissenschaft klappt. Man darf der Öffentlichkeit nicht nach dem Mund reden, man muss auch raus und kommunizieren. Es gibt einen gesellschaftlichen Diskurs, in dem die WissenschaftlerInnen zu den Intellektuellen gehören sollten.
Wenn Sie jetzt die Ausgangsbeschränkungen durch Covid 19 Revue passieren lassen – wie ist das aus Ihrer Sicht gelaufen?
Covid 19 war wie für viele andere Bereiche auch für die Universitäten sehr ambivalent. Wir haben heute unter vernünftigen Leuten die Übereinkunft, wie wichtig die Grundlagenforschung ist. Man möchte sich nicht vorstellen, wie Covid unter der Zeit des 1/4-Telefons (Telefonanschluss, den sich vier Haushalte teilen, Anm.) gelaufen wäre. Man möchte sich nicht vorstellen, wie sich eine Pandemie in Zeiten verhalten würde, in denen man keine Voraussetzungen dafür vorfindet, Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Das hat man in Österreich sehr klug gemacht. Die Politiker haben die WissenschaftlerInnen angehört und dann die wichtigen Entscheidungen getroffen. Das Bewusstsein ist gestärkt, dass Wissenschaft etwas Notwendiges ist, ohne die wir nicht auskommen. Denken Sie, dass die Leute aus der Krise gelernt haben? Die Leute hat es ja sehr ungleichmäßig getroffen. Leute wie ich sind weniger gereist, zuhause gesessen und waren überhaupt nicht eingeschränkt, haben Garten- und Hundespaziergänge genossen und sich ganz hervorragend gefühlt. Das ist bei Leuten mit kleinen Kindern schon etwas anders gewesen. Und bei Leuten, die auf Kurzarbeit waren oder sind, oder ihre Arbeit verloren haben, ist das etwas ganz anderes. Es gab eine anfängliche Solidarität, die ein typisches Merkmal für Krisen ist. Das hat sich sehr günstig auf die Befindlichkeiten der Leute ausgewirkt und hat signalisiert – so neoliberal rücksichtslos ist unsere Gesellschaft doch nicht. Wenn es darauf ankommt, dann können wir schon zusammenstehen. Die Menschen sind jetzt mehr in die Natur gegangen.
Denken Sie, dass die Krise einen Anstoß für einen natürlichen Lebensraum gebracht hat?
Das war nicht nur ein Anstoß. Das hat in ein natürliches Wesensmerkmal von Menschen eingeklinkt. Verunsicherung durch Krise bedingt auch, dass sich Menschen in Richtung Natur orientieren. Es gab eine irrsinnige Nachfrage bei Hundezüchtern und einen Boom nach Schrebergärten. Gleichzeitig passiert ein enormer Digitalisierungsschub. Ist das menschliche Gehirn dafür vorbereitet – aus evolutionsbiologischer Sicht? Das menschliche Gehirn hat ein enormes Potenzial, was kognitive Leistungen betrifft. Es ist schon etwas eingeschränkter, wenn es um Umstellung, Kommunikation und soziale Dinge geht. Auch dieses Ding hat wieder zwei Seiten. Einerseits hätten wir uns alle nicht vorstellen können, in den Unis, in den Betrieben, in den Schulen, dass wir innerhalb weniger Wochen zu digitalen Kommunikationsexperten werden. Wenn man es für die Schulen richtig macht – die Laptop-Offensive der Regierung etwa ist ein Schritt in die richtige Richtung –, dann bereitet man das Feld für eine wesentlich flexiblere Schule. Der Präsenzunterricht wird nie zu ersetzen sein. Wenn ich zusätzlich Möglichkeiten habe, auf elektronischem Weg Schule und Uni zu machen, dann bin ich viel flexibler. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir diese elektronischen Medien erst seit wenigen Jahren nutzen. Zu viel Medienkonsum ist schlecht für die Intelligenz- und Gehirnentwicklung der Kinder. Ich glaube, dass man mit den neuen und unglaublich potenten technischen Möglichkeiten lernen muss umzugehen. Heutzutage geht es nicht, ein Kind ohne Smartphone aufwachsen zu lassen. Damit ist es aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Elektronische Medien sind zu einer wahnsinnig wichtigen Kulturtechnik geworden, ähnlich wie Lesen und Schreiben. Damit muss man leben. Erwachsene müssen ihre Smartphone-Sucht auch in den Griff kriegen.
Welche Rolle hat der Wildpark Ernstbrunn in Ihrer Forschungsarbeit?
Der Wildpark Ernstbrunn ist eine Gründung des Fürsten Reuss. Wir haben uns vor elf Jahren als Wolfs- forschungszentrum auf Einladung dort assoziiert. Es ist ein Gebiet, wo wir uns mit unserer Grundlagen- forschung austoben können. Wir haben dort in Kooperation mit dem Park an die 50.000 Quadratmeter Gehegeflächen gebaut. Wir haben die wissenschaftlichen Einrichtungen finanziert, der Wildpark die Zäune. Es ist das Gebiet der Leiserberge, ein reichhaltiger Eichenmischwald mit einer viefältigen Vogelfauna, ein ehemaliger riesiger Schlosspark. Es gibt einen tollen Unterwuchs, es ist ein fantastisches Gebiet. Ein „großer Vorteil“ in der Forstwissenschaft ist, dass sich Bäume kaum bewegen. Sie sind sehr stark mit ihrem Standort verbunden.
Wie gehen Sie mit der Mobilität Ihrer „Forschungssubjekte“ um? Welche Herausforderungen gibt es da?
Gar keine eigentlich. Unsere Wölfe und Hunde leben in Gehegen und sind Partner; das ist nicht nur so gesagt. Mit Wölfen kann man hervorragend kooperieren, weil man sie gut motivieren kann. Zwingen kann man sie zu nichts, einen Hund könnte man. Wir wissen immer, wo die Hunde und die Wölfe sind. Wir arbeiten nicht mit Freilandwölfen. Wir sind nicht rausgegangen und haben erwachsene Wölfe gefangen, sondern wir haben sie als Welpen bekommen. Wir ziehen sie per Hand auf und sozialisieren sie gut, sie bleiben bis zu ihrem Lebensende dort. Unsere ältesten Wölfe sind jetzt zwölf. Wir machen ausführliche Experimente zur Frage, wie sich Hunde von Wölfen unterscheiden. Das ist eine ganz wichtige Frage, weil es seit 35.000 Jahren keine Menschen mehr ohne Hunde gibt. Hunde waren ein wichtiger Faktor in der Phase der Zivilisationsentwicklung der Menschen.
Welche Verhaltensrichtlinien empfehlen Sie, wenn man einem Freilandwolf begegnet?
Das steht zum Beispiel sehr gut im neuen Buch von Klaus Hackländer (Professor an der Universität für Bodenkultur Wien; „Er ist da.“ Ecowin). In Kürze: Wenn man auf dem Wanderweg einem wolfsähnlichen Tier gegenübersteht und es geht nicht weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Wolf handelt, gering. Meistens ist es ein Hund, der gerade streunt. Man sollte sich freuen, dass man einen Wolf im Freiland sieht, sollte der Wolf nicht weggehen, reicht es vollkommen die Hände in die Höhe zu geben, sich groß zu machen, ihn anzuschreien, am Boden zu stampfen, irgendetwas zu schmeißen. Das wirkt bei Wölfen immer. Nicht nett sein, nicht das Tier vielleicht noch anfüttern, die Wölfe, die in den letzten paar Jahren Probleme gemacht haben und auch abgeschossen wurden, das waren immer angefütterte Wölfe.
Sollte man sich mit dem Wolf beschäftigen, wenn man einen Hund hat?
Es ist insofern interessant, wenn man wissen möchte, warum sich Hunde so verhalten, wie sie es tun. Ein Blick auf den Wolf ist relativ lehrreich. Man sollte aber nicht den Fehler machen, den Wolf als Maßstab für den Umgang mit Hunden zu nehmen Hunde sind keine Wölfe mehr. Daran forschen wir systematisch in Ernstbrunn, um herauszufinden, was das für das Zusammenleben mit Hunden bedeutet.
Ihr letztes Buch geht in Richtung Evolutionsbiologie Mensch. Darin steht der Satz: „Von kleinen Nischen abgesehen, sind intellektuelle Spitzenleistungen für ein gelingendes Leben nicht wichtig“. Welches Feedback bekommen Sie von Ihren KollegInnen zu solchen Sätzen?
Gar keine. Die nehmen das nicht so ernst. Wir haben aufgrund der 600 Millionen Jahre währenden Evolution als Wirbeltier alles Mögliche an unterschiedlichen Verhaltenstendenzen mitbekommen. Man sollte aber nicht den Fehler machen, den Wolf als Maßstab für den Umgang mit Hunden zu nehmen. Ganz ursprüngliche lebenserhaltende reproduktionsfördernde Instinkte, um es einfach zu sagen, und dann gibt es komplexe Anpassungen in den letzten paar Millionen Jahren als wir wirklich ein differenziertes Sozialleben entwickelt haben. Vor 700.000 Jahren „explodierte“ unser Gehirn förmlich und hat uns zu einer kognitiven Leistung befähigt, mit dem es kein anderes Tier aufnehmen kann. Wenn Sie sich die Entwicklung der abendländischen Philosophie anschauen, ist der Grundtenor Emanzipation des Menschen von Tieren und Natur – Transzendieren des Menschen zum Geisteswesen, das machen die Theologen, das machen die Philosophen und alles was, dagegen spricht, gilt immer noch als Beleidigung. Nicht alle waren so. Michel de Montaigne hatte eine sehr körperliche Theorie von Gefühlen und Geist. Andere Philosophen der Aufklärung wie René Descartes oder Immanuel Kant waren völlig durchgeistigte Typen. Sie unterschätzten die Wichtigkeit des sozialen Verhaltens. Was ich kritisiere ist, den Menschen zum Geisteswesen zu machen und dabei zu vergessen, dass wir prinzipiell soziale Wesen sind. Was wir an unseren Schulen brauchen, ist Bildung in diese Richtung, also nicht nur rationale Bildung, sondern auch die soziale und die Herzensbildung. Wir werden keine Chance haben, mit der Zukunft zurechtzukommen, wenn wir uns nur auf Rationalität und Technologie verlassen. Es liegt in der Natur des Menschen, sich anhimmeln zu lassen, aber auch teilzuhaben. Ohne Gleichstellung der Geschlechter verpasst eine Gesellschaft ihr Optimum an Kreativität und das Optimum möglichst viele Menschen zufrieden zu stellen. Das ist ja ein Hauptziel der Politik – und die Kapazität, Lösungen für Probleme zu finden. Autoritären, patriarchalen Gesellschaften fehlt das.
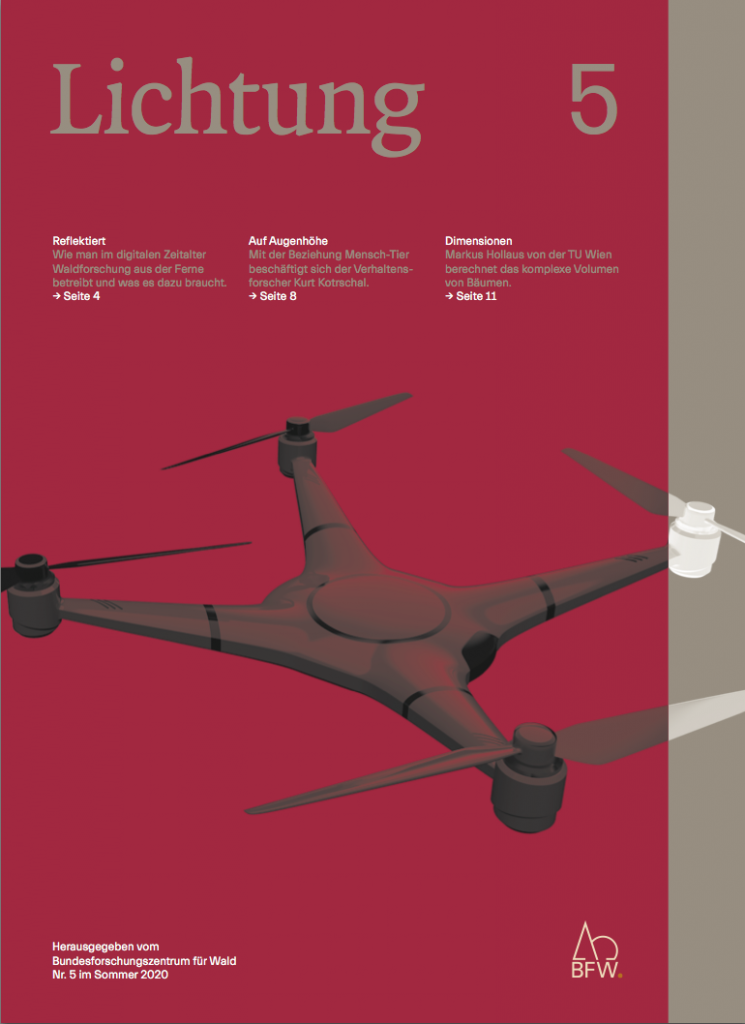
Das Interview ist aus der aktuellen Ausgabe zum Thema „reflektiert“ 
Verhaltensforscher
Univ. Prof. Dr. Kurt Kotrschal