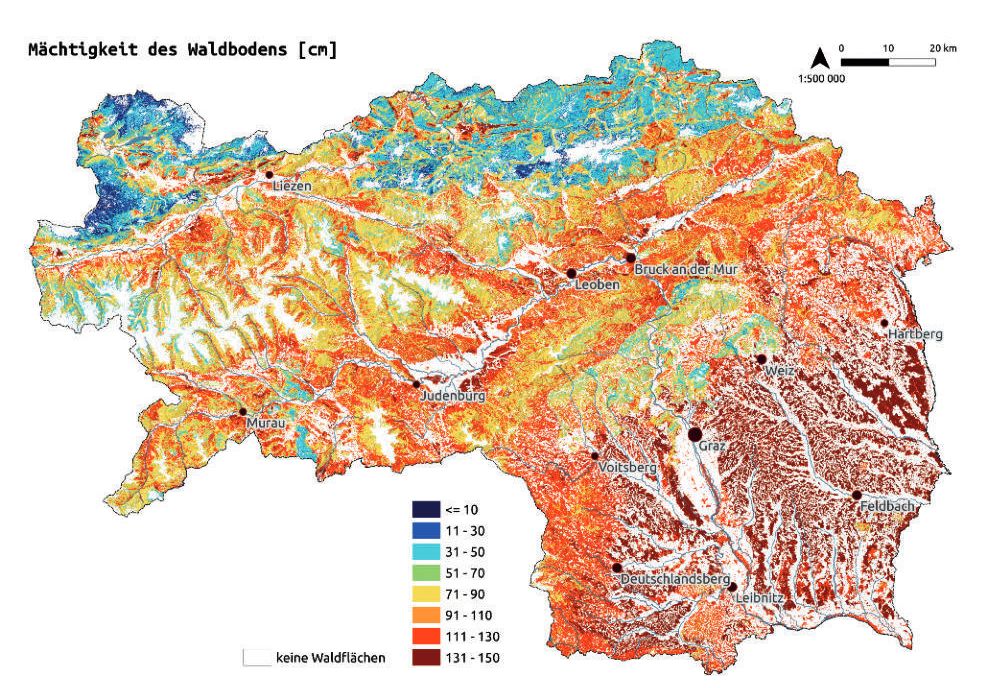Fachinstitut
Naturgefahren
Das Institut für Naturgefahren entwickelt praxisorientierte Methoden, um menschlichen Lebensraum zu sichern. Im Mittelpunkt stehen Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Wirkung alpiner Naturgefahren, wie Lawinen, Muren, Wildbäche und Rutschungen. Damit werden wichtige Grundlagen für einen nachhaltigen Schutz des alpinen Lebensraumes bereitgestellt, insbesondere dafür, dass der Wald auch in Zeiten der Klimaänderung und des gesellschaftlichen Wandels seine vielfältigen Leistungen für Mensch und Natur erbringen kann.